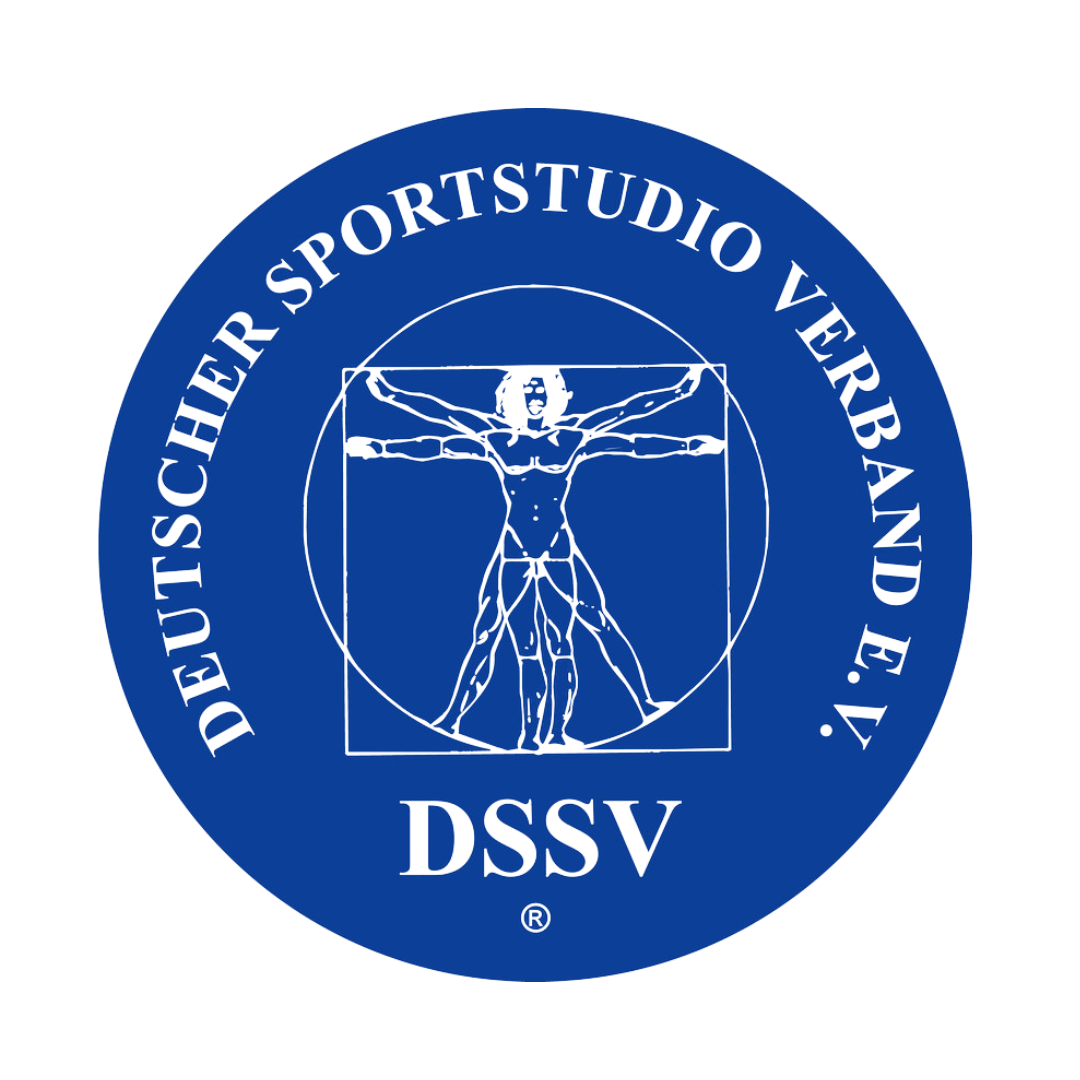… und es macht doch glücklich!
Ein bekannter Glaubenssatz ist, das Sport glücklich macht. Aber stimmt das wirklich? Einige Psychater ziehen die Wirkung des Glückshormons Serotonin zur Behandlung von Depressionen in Zweifel. Die Forschung sagt: Es müssen letztendlich mehrere Faktoren zusammenwirken.
Trainieren vertreibt schlechte Laune und wirkt sogar gegen Depressionen. Ganze Generationen von fitten Menschen würden auf diesen Glaubenssatz ihr letztes Trainingsshirt verwetten. Doch jetzt ziehen einige Psychater die Wirkung des Glückshormons Serotonin zur Behandlung von Depressionen in Zweifel. Sie verweisen darauf, dass bei depressiven Menschen kein Mangel an Serotonin nachweisbar sei. Wie jetzt – alles für die Katz? Wirkt Training doch nicht als Stimmungsaufheller?
Professor Andreas Ströhle von der Berliner Charité widerspricht: „Dass Serotonin einen Einfluss auf die Stimmung hat, ist ja nicht ganz falsch, aber auch nicht so einfach, wie es klingt. Da wirken mehrere Faktoren zusammen.“ Einer der Faktoren ist körperliche Aktivität – oft vereinfachend als Sport bezeichnet. Die täglich zurückgelegten Schritte sind zwar noch kein Sport, aber sie haben offenbar einen Einfluss auf die menschliche Psyche. Welche klinischen Effekte eine Steigerung der täglichen Schrittzahl auf die Stimmung hat, untersucht Professor Ströhle derzeit im Rahmen einer Studie.
Bewegung für die Psyche
In der SAD-Studie („Schritte aus der Depression“) sollen 400 Patienten aus acht psychiatrischen Kliniken ihr tägliches Bewegungspensum von durchschnittlich 4.000 auf das von der Weltgesundheits-Organisation WHO empfohlene Maß von 10.000 Schritten erhöhen und dann beibehalten. Jede Woche sollten sie dabei 500 Schritte mehr schaffen.
Fitness-Experten erhoffen sich dadurch auch Antwort auf die Frage, wie viel Training zur Entstehung des Glückshormons nötig ist, um gegen Depressionen wirksam zu sein. Denn außer Serotonin haben auch andere Stoffe Einfluss auf die Stimmung. Aber auch die entstehen im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten. „Beteiligt ist zum Beispiel auch „ANP“ (artriale natriuretische Peptid), ein Hormon, das im Herz-Muskel gebildet wird“, berichtet Professor Ströhle. „Schon vor 20 Jahren haben wir zuerst in Tierversuchen und vor 15 Jahren beim Menschen gezeigt, dass es gegen Angst wirkt.“
ANP und BDNF
ANP entsteht aufgrund von Dehnungsreizen in den Muskelzellen des Herzvorhofes. Wodurch werden diese Dehnungsreize besonders intensiv ausgelöst? Richtig, durch körperliches Training.
Auch BDNF (brain derived neurotrophic factor) verbessert das psychische Wohlbefinden. „BDNF,“ erklärt Studienleiter Ströhle, „stimuliert das Nervenwachstum und verstärkt die Bindung zu anderen Nerven. BDNF wird vermehrt durch sportliche Aktivitäten gebildet.“ BDNF wird zwar auch schon durch eine einzelne Trainingseinheit ausgeschüttet, die kontinuierliche Versorgung verlangt jedoch regelmäßiges und dauerhaftes Training – das entspricht also genau der Philosophie einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio.
Was zu welchen Anteilen letztlich gegen Depressionen wirkt, darüber streiten noch die Gelehrten. Unbestritten ist, dass der Körper Serotonin aus der Aminosäure Tryptophan bildet und als Botenstoff zur Steuerung zahlreicher Prozesse einsetzt. Serotonin beeinflusst nicht nur Stimmungen und Emotionen, sondern regelt auch die Körpertemperatur, den Appetit, den Wach-Schlaf-Rhythmus und das Schmerzempfinden. Neben seinen Aufgaben innerhalb des Gehirns übernimmt Serotonin noch wichtige Funktionen in anderen Bereichen des Körpers. Es weitet die Blutgefäße, Bronchien und Darmzellen und stimuliert die Arbeit der Thrombozyten im Blut.
Serotoninspiegel
Der Serotoninspiegel kann durch Nahrungsmittel, Licht und körperliches Training erhöht werden. Der Grundstoff Tryptophan ist vor allem in proteinreichen Lebensmitteln wie Fisch. Fleisch, Sojabohnen und Erbsen enthalten. Auch die Vitamine B3 und B6 sowie Magnesium und Zink werden als Serotonin-Bausteine benötigt. Und Schokolade, Bananen oder Walnüsse sollen das Glückshormon sogar direkt ausschütten. Das gelangt dann zwar in den Körper, nicht aber ins Gehirn, den Ort, an dem die Gefühle entstehen.
Dass Licht den Serotoninspiegel und die Stimmung hebt, wurde bereits von einer kanadischen Studie bestätigt, in der Frauen, die an einem Tryptophanmangel litten, mit hellem Licht bestrahlt wurden. Allerdings entsprachen die 3.000 Lux gerademal dem Tageslicht an einem bewölkten Wintertag. Da macht ein Gang auf die Sonnenbank nach dem Cooldown mehr Sinn.
Rezept für Bewegung
Wie bereits moderate Bewegung vor Depressionen schützen kann, hatten Forscher der University of New South Wales schon 2017 herausgefunden: Eine Stunde Training in der Woche reiche bereits, um die geistige Gesundheit zu verbessern – unabhängig von Geschlecht und Alter. Dabei käme es weniger auf die Intensität als vielmehr auf die Regelmäßigkeit des Trainings an.
Norwegische Wissenschaftler bestätigten das Quantum Training nach einer elf Jahre dauernden Studie mit 34.000 Erwachsenen. Sie errechneten aus den Ergebnissen, dass zwölf Prozent aller Depression durch körperliche Aktivitäten verhindert werden könnten. Bewegungsmuffel hätten dagegen ein um 44 Prozent höheres Risiko depressiv zu werden. Allerdings habe die Studie auch gezeigt, dass eine Stunde pro Woche nicht ausreiche, um auch Angstzustände zu verhindern.
„Wenn wir es schaffen würden, dass sich die Bevölkerung nur ein bisschen mehr bewegt, dann würde das nicht nur die seelische Gesundheit ganz enorm verbessern, sondern auch das körperlich Wohl“, zitiert das Berliner Zentrum der Gesundheit Professor Samuel Harvey, den Leiter der Studie. So gesehen staunt der Fachmann und der Laie wundert sich, dass die 5,3 Millionen Deutschen, die jährlich an einer Depression erkranken, nicht längst mit einem Rezept für Bewegung versehen therapiert werden. Dieses Rezept ist immerhin seit 2015 im Präventionsgesetz vorgesehen.
Quelle: shape UP

Alternative Bezeichnungen für das krankhafte Verhalten sind Muskeldysmorphie, Biggerexie und Adoniskomplex. Letzteres ist eine Wortschöpfung, die in den 1990er-Jahren durch Arbeiten des US-amerikanischen Psychiaters und Harvard-Professors Harrison G. Pope bekannt wurde. Und warum ist der Adoniskomplex gerade im Gespräch? Nun, in der schlagzeilenarmen Fitnesswelt sind Anomalien natürlich ein dankbares Thema – den Schuh müssen auch wir uns anziehen. Zu besonderer Aktualität gelangte das Ganze durch den medial vielfach verbreiteten Bericht „Männer und die Muskelsucht“. Pubertäre Ursprünge Muskelsucht betrifft in erster Linie junge Männer. Muskelsüchtige Frauen gibt es auch, aber sie bilden eine nicht näher zu beziffernde Minderheit. Die Tendenz zu dieser Störung wird oft schon in der Pubertät gelegt. So finden sich unter den Betroffenen zum Beispiel Männer, die im Kindes- und Jugendalter adipös waren oder gehänselt wurden. Im Rahmen der sogenannten POPS-Studie (Potsdamer Prävention von Essstörungen) wurden Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren unter anderem zu Gewicht und Muskeln befragt. Knapp 70 Prozent der männlichen Befragten berichteten, unzufrieden damit zu sein. Der Ausbruch eines gestörten Verhaltens erfolgt allerdings häufig erst zwischen dem 17. und 24. Lebensjahr. Kein Stückchen selbstsicher Was zeichnet Muskelsucht aus? Dass sie gar nicht so leicht zu erkennen ist, wäre eine Antwort. Nicht alle, die ihren Körper mit Ehrgeiz formen sind diesem Krankheitstyp zuzuordnen. Männer, die sich im Fitnessstudio selbstbewusst vor den Spiegel stellen oder abfotografieren, gehören eher nicht zu den Betroffenen. Muskelsüchtige scheuen Selfies und wenn sie sich selbst betrachten, ist ihr Blick eher skeptisch. Zudem gilt, dass nicht jeder zwangsläufig muskelsüchtig ist, der … … soziale, berufliche oder freizeitliche Aktivitäten aus dem nicht kontrollierbaren Bedürfnis heraus aufgibt, Trainings- und/oder Diätpläne einzuhalten. … Situationen meidet, in denen sein Körper den Blicken anderer ausgesetzt wird. … sich übermäßig mit der Unzulänglichkeit von Körperumfang oder Muskulatur beschäftigt. … Übertraining, Diäten oder die Einnahme leistungssteigernder Substanzen aufrechterhält, obwohl die schädlichen Folgen bekannt sind. Wenn allerdings mindestens zwei der vier genannten Kriterien zutreffen, besteht höchste Muskelsuchtgefahr. Die hohe Bedeutung des Aussehens für die Selbstbewertung geht dann mit einem niedrigen Selbstwertgefühl einher. Wird zudem noch sozialer und/oder medialer Druck wahrgenommen, verstärkt sich die Körperunzufriedenheit. Und das ist häufig der Fall, denn Muskulöse gelten als männlicher, attraktiver und erhalten von Altersgenossen oft mehr Anerkennung und Respekt. So kann Körperunzufriedenheit letztlich zu Exzessen führen. Trainingspläne werden zur Qual, die Gedanken kreisen um Körpermaße oder Nahrung, diese andauernde Beschäftigung baut wiederum Stress und Druck auf, der als defizitär empfundene Körper weckt Schamgefühle. Es entwickelt sich eine psychische Belastung oder Störung, die Einschränkungen im sozialen und beruflichen Bereich nach sich ziehen kann. Muskelsucht ähnelt Magersucht Obwohl das Krankheitsbild viele Jahre bekannt ist, wird das Thema nicht so breit diskutiert wie die vergleichbare und tendenziell weibliche Magersucht. Exakte Zahlen fehlen. Eine Schätzung liegt bei mindestens 80.000 Betroffenen. Mager- und Muskelsucht weisen weitere Analogien auf. Die einen fühlen sich zu dick, die anderen zu schmächtig. Beide Seiten verwenden in der Folge eine Menge Energie darauf, ihre Figur zu verändern. Dabei kommt es zu Wahrnehmungsstörungen: Der Körper wird trotz Ideal- oder Untergewicht beziehungsweise formidabler Muskelmasse immer noch als unzureichend empfunden und die Maßnahmen werden weiter verstärkt. Aber es gibt auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Männer weisen bei ihrer Sucht höhere psychische Begleiterkrankungen auf. Somit leiden sie häufiger an Substanzmissbrauch und -abhängigkeit (auch Alkohol), Spiel-, Arbeits- oder Computersucht. Zudem ist das starke Geschlecht nicht unerheblich durch die wandelnde gesellschaftliche Rollenverteilung verunsichert. Frauen dringen zunehmend in Männerdomänen ein, sodass Körper und Muskeln zunehmend zur Definitionsquelle von Männlichkeit werden. Da verwundert es wenig, dass Männer in traditionellen Frauenberufen ebenso wie solche mit sexuell bezogenen Ängsten zu den Risikogruppen der Muskelsucht gehören. Vertreter des männlichen Geschlechts erleben sich im Vergleich zu Frauen zudem als sportlich kompetenter sowie leistungsfähiger. Sie sind dadurch überzeugter, körperliche Zustände aktiv beeinflussen und kontrollieren zu können. Folgen der Muskelsucht Der Muskelsüchtige muss Sport treiben, seine auf das Aussehen bezogenen Aktivitäten haben einen zwanghaften Charakter. Die Folge sind exzessive sportliche Aktivitäten, Essstörungen und häufig auch die Einnahme leistungssteigernder Substanzen. Dass dabei gesundheitliche Schäden auftreten können, ist nur allzu verständlich. Exzessives Sporttreiben Hier besteht vor allem das Risiko, körperlicher Selbstzerstörung durch extremes Gewichtstraining. Gefahren des Übertrainings sind: Leistungsstagnation bis hin zum Leistungsabfall Erhöhter Ruhepuls und systolischer Blutdruck, verzögerter Rückgang der Herzfrequenz nach Belastung Bei Wechsel in die aufrechte Körperlage auftretende Regulationsstörungen des Blutdrucks, Schwindel, Übelkeit bis hin zum Kollaps Ungesunder Gewichtsverlust Erhöhte Infektanfälligkeit Schlafstörungen, Antriebslosigkeit Verletzungen, Schmerzen, Muskel- und Gelenküberbelastungen Essstörungen Daheim geht das Optimierungsprogramm oftmals weiter. In dem eingangs erwähnten Bericht Männer und die Muskelsucht heißt es, dass an manchen Tagen bis zu 5.000 Kilokalorien (kcal) zugeführt werden, um keine Muskelmasse zu verlieren. Das entspräche etwa der Menge von drei Nudelpackungen zu je 500 Gramm. Der Klassiker bei Kraftsportlern sei Hühnchen mit Reis – eine fettarme, proteinreiche Mahlzeit, die aber auf Dauer nicht den Ansprüchen einer ausgewogenen Ernährung genügt. Weil der Körper dann an Mangel leidet, würden Pillen mit Vitaminen, Mineralien und Nährstoffen eingeworfen. Die zusätzliche Aufnahme von Präparaten über den durch die Nahrungsaufnahme allgemein abgedeckten Tagesbedarf kann aber zu Problemen führen. Unter Fitnesssportlern besonders beliebt sind das für den Muskelaufbau maßgebliche Protein und das als Energiespeicher genutzte Kreatin. Zu viel Protein kann zu übermäßigem Harnstoff (Abbauprodukt von Eiweiß) führen. Das wiederum belastet den Stoffwechsel und die Nieren. Im Falle der Hochdosierung kann auch Kreatin die Nierenfunktion beeinträchtigen. Des Weiteren wird von Wassereinlagerungen in den Muskelzellen berichtet, die ein steigendes Verletzungsrisiko bewirken. Auch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie Muskelkrämpfe sind mögliche Konsequenzen. Einnahme von leistungssteigernden Substanzen Auf der „Hitliste“ der unter Kraftsportlern gehandelten Leistungsverstärker stehen als Anabolika Steroid- und Wachstumshormone sowie Clenbuterol ganz weit oben. Beliebt ist auch Ephedrin, ein appetitverminderndes Mittel zur Stimulanz des Zentralnervensystems, das den Krafterhalt nach der Einnahme von Anabolika unterstützt. Diese Substanzen können folgende Nebenwirkungen haben. Steroidhormone: Erhöhte Anfälligkeit für Verletzungen an Bändern und Sehnen, Stimmungsschwankungen, Aggressionen bis zur Gewalt, Beeinträchtigung des Urteils- und Wahrnehmungsvermögens, psychotische Wahnvorstellungen und hohes Suchtpotential. Clenbuterol: Herz-Kreislauf-Komplikationen, Schlafstörungen und negative Auswirkungen auf den Knochenaufbau. Wachstumshormon (hGH) : Hohe Dosen führen zu Diabetes, Leber- und Knochenschäden. Ephedrin: Nervosität | Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Herzrasen | Schweißausbrüche, bei hoher Dosis Krampfanfälle | Psychische Veränderungen | Auch Todesfälle sind bekannt An dieser Stelle darf der wichtige Hinweis nicht fehlen, dass Muskelsüchtige nur einen kleinen Teil der Missbrauchbetreibenden bilden. Genaue Zahlen gibt es nicht, da in deutschen Fitnessstudios aus rechtlichen Gründen keine Dopingkontrollen durchgeführt werden. Einen Anhaltspunkt bietet die sogenannte Multicenter-Studie, die auf Befragungen erfahrener Studiobesucher basiert. Die Arzneimittelmissbrauchsquote beträgt demnach 22 Prozent bei Männern und acht Prozent bei Frauen, die Gesamtquote liegt bei 19 Prozent. Gegenmaßnahmen Betroffene erkennen die Problematik oftmals sehr spät oder gar nicht und sollten durch Angehörige, Freunde oder Partner darauf aufmerksam gemacht werden. Reflektieren kann helfen. Gut ist, sich zu vergegenwärtigen, dass viele andere die gleichen Bedenken bezüglich des Äußeren haben, damit aber einen gesünderen Umgang pflegen. Innerlicher Protest ist ebenfalls ein probates Mittel. Protest dagegen, dass Medien und Werbung oder leicht daherredende Alters- und Geschlechtsgenossen diktieren, wie man auszusehen hat. Auch Influencer wie etwa Trainer, die Körpergewicht und -zusammensetzung mit Erfolg oder Misserfolg in Beziehung setzen, sollten kritisch hinterfragt werden. Insgesamt muss der Muskelsüchtige realisieren, dass ein subjektiv negatives Körperbild zu nichts führt, und nach anderen Quellen gesunder Selbstachtung suchen. Gegebenenfalls ist auch Hilfe von außen angeraten. In manchen Städten finden sich entsprechende Einrichtungen der Caritas oder Beratungszentren für Essstörungen. An der Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erhalten Betroffene und andere Personen eine Erstberatung und Adressen, an die sie sich wenden können. Quelle: shape UP

CBD ist sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft angekommen. Es entsteht der Eindruck, der Wirkstoff sei eine Wunderwaffe. Ihm werden unter anderem entspannende, schmerzlindernde und regenerationsfördernde Wirkung nachgesagt. Eine Befragung zum Konsum von CBD-Produkten bestätigt: Die Hanfpflanze liegt wieder voll im Trend. Das Nahrungsergänzungsmittel steht gleichzeitig in der Debatte: Es geht um eine korrekte Deklarierung, ein sauberes Produkt und den richtigen Einsatz. Bisher gibt es kaum klinische Studien zur Wirksamkeit und keine eindeutigen Dosierungsvorgaben für das Produkt. Inhaltstoffe nicht verwechseln CBD-Produkte werden schnell mit Drogenkonsum in Verbindung gebracht. Richtig ist, dass die beiden Wirkstoffe Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) in der Hanfpflanze stecken. Sie haben aber unterschiedliche Wirkweisen. THC ist beispielsweise für das Gefühl beim Marihuanakonsum verantwortlich. Der psychoaktive Wirkstoff ist in Deutschland verboten und unterliegt den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes. CBD wirkt hingegen nicht psychoaktiv. Die World Health Organisation (WHO) stuft es als unbedenklich ein: CBD mache nicht abhängig und habe keine signifikanten Nebenwirkungen. Unbewusster Drogenkonsum Hersteller von CBD Produkten extrahieren den Wirkstoff aus der Hanfpflanze. Und genau hier liegt für Konsumenten der eigentliche Hund begraben. Denn wenn dieser Extrahierungsvorgang unzureichend ist, kommt der verbotene Wirkstoff THC mit in das eigentlich erlaubte Produkt. 2017 untersuchten Forscher beispielsweise den Gehalt von CBD und THC bei Waren, welche in Onlineshops vertrieben wurden. Unter anderem stellten die Wissenschaftler bei 18 Produkten einen viel zu hohen THC-Gehalt fest. Teilweise war der angegebene CBD-Gehalt auch falsch: Getestete Handelsgüter waren zum Teil unterdosiert. THC kann im Körper gespeichert werden. Im Urin ist das Molekül vier bis sechs Wochen nachweisbar. Personen, die regelmäßig CBD-Produkte zu sich nehmen, welche einen geringen THC-Gehalt beinhalten, laufen damit immer Gefahr, positiv auf Drogen getestet zu werden. Profisport Die Hanfpflanze enthält insgesamt über einhundert bekannte Cannabinoide. Das einzig legale Cannabinoid im Sport ist CBD. Die WADA hat sich über die Gründe zur Akzeptanz von CBD nicht explizit geäußert. Es lässt jedoch vermuten, dass Kriterien, die für die Verbotsliste herangezogen werden, bei CBD in Anbetracht des aktuellen Kenntnisstandes nicht zutreffen. Allerdings weist die NADA explizit auf die Möglichkeit hin, dass CBD-Produkte auch THC beinhalten können. Auf THC positiv getestete Sportler werden sanktioniert. Breitensport und Autofahrer Breitensportler müssen zwar nicht mit Dopingkontrollen rechnen. Dennoch ist die Reinheit des CBD-Produktes auch hier ein Thema. Der Wirkstoff THC kann die Wahrnehmung und Entscheidungsfindung beeinflussen. Insbesondere bei Risikosportarten kann das gefährlich bis fatal sein. Im Renn- oder auch Skisport müssen Athleten blitzschnell entscheiden, ob sie ein gewagtes Manöver fahren. Bei Kontaktsportarten ist eine klare Einschätzung der Situation ebenfalls unabdingbar. Abgesehen von der sportlichen Betätigung sollten sich auch Autofahrer mit den Inhaltsstoffen von CBD-Produkten auseinandersetzen. Jeder Autofahrer kann in eine Polizeikontrolle geraten. Auch bestimmte Berufsgruppen wie etwa Piloten oder Krankschwestern könnten bei einem Drogentest unerwartete Ergebnisse erhalten. Positive Effekte? Aktuell ist die Studienlage zu CBD-Produkten noch relativ dünn, jedoch auch vielversprechend. Erste Effekte konnten beispielsweise bei der Knochenregeneration beobachtet werden. Auch bei Angst- und Schlafproblemen scheint ein positiver Einfluss möglich. Über eine schmerzlindernde Wirkung wird ebenfalls berichtet. Etwas weiter ist die Forschung schon in Bezug auf die Epilepsie. Inzwischen gibt es ein Fertigarzneimittel auf CBD-Basis. Einschätzung der Produkte Der Wirkstoff CBD ist grundsätzlich erlaubt und ungefährlich. Die Eigenverantwortung an Konsumenten ist allerdings hoch, da die Qualität der Produkte auf dem Markt so vielschichtig ist. Ein Indikator für eine niedrige Qualität bei den Produkten ist der CBDA-Wert. Das Molekül ist eine Vorstufe des CBDs. Ist die CBDA-Konzentration hoch, spricht das für ein unzureichend extrahiertes Produkt. Die CBD-Prozentangabe auf Produkten zeigt an, wie viel Wirkstoff sich im Produkt befindet. Diese Angabe ist insbesondere für den Verwendungszweck des Cannabinoids entscheidend. Produkte mit niedriger CBD-Dosierung, wie etwa fünf Prozent, können im Rahmen der Nahrungsergänzungsmittel vertrieben werden. Das entspricht einer Flasche mit zehn Milliliter Öl und 500 Milligramm CBD. Eine angebrochene Flasche ist etwa bis zu sechs Wochen haltbar. Quelle: shape UP

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das Risiko an Vorhofflimmern zu erkranken reduziert werden kann. Wesentlich dabei sind Veränderungen des Lebensstils, wie eine Gewichtsreduktion und die Steigerung der körperlichen Aktivität – besonders in Form von Ausdauertraining. Dieses wirkt nicht nur präventiv, sondern kann sogar die Symptome einer bereits bestehenden Erkrankung reduzieren und so den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. So lässt sich mit Hilfe sportlicher Aktivität nach einer Verödungstherapie des Vorhofflimmerns (Katheterablation) die Prognose verbessern. „Regelmäßige körperliche Aktivität und ein Normalgewicht sind ganz besonders wichtig, um kardiovaskuläre Risikokrankheiten in die Zange zu nehmen, die Vorhofflimmern begünstigen oder verursachen, allen voran Bluthochdruck, gefolgt von koronarer Herzkrankheit, Diabetes mellitus und dem Schlafapnoesyndrom. Mit Bewegung lässt sich sehr effektiv starkes Übergewicht vermeiden, das Bluthochdruck und Vorhofflimmern begünstigt“, betont der Kardiologe Prof. Dr. med. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Wieviel Bewegung ist nötig? Laut Experten sollten Erwachsene und ältere Menschen über 65 Jahre 150-300 Minuten Ausdauertraining mit moderater Intensität durchführen. Das kann zügiges Gehen, Joggen, Radfahren, Schwimmen oder Ergometer-Training sein. Optional kann der Trainingsumfang auch 75 bis 150 Minuten pro Woche betragen, wobei hier die ausdauerorientierten Bewegungen etwas anstrengender sein sollten. „Vorhofflimmerpatienten sollten ihre Trainingsdosis immer mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen“, rät Prof. Voigtländer, Ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien-Krankenhauses Frankfurt am Main. Denn bei Betroffenen, die Medikamente einnehmen, welche die körperliche Leistungsfähigkeit senken, müsse zuerst der optimale Trainingspuls angepasst werden. Wer Sport zur Vorbeugung einsetzen möchte, sollte beim Trainingsumfang bedenken, dass bei moderater Ausdauerbelastung das Vorhofflimmerrisiko signifikant sinkt, wohingegen es bei häufiger intensiver Belastung eventuell steigen könnte. „Für Ausdauersport gilt die Faustregel: Bei sechs Stunden oder mehr an intensivem Ausdauertraining pro Woche kann bei Männern das Vorhofflimmerrisiko steigen“, erklärt Dr. med. Jonas Zacher, Diplom-Sportwissenschaftler und Sportmediziner mit Schwerpunkt Sportkardiologie am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Sporthochschule Köln. Zusätzliches Krafttraining? Einige wissenschaftliche Studien zeigen, dass körperliches Training eine sinnvolle Behandlungskomponente für Menschen mit Vorhofflimmern ist. Die WHO empfiehlt eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Zusätzlich zum Ausdauertraining sollten Betroffene zwei Tage die Woche mit leichtem Hanteltraining oder funktionsgymnastischen Übungen die Muskulatur kräftigen. Bei Menschen ab 65 Jahren werden zudem dreimal pro Woche Gleichgewichts- und Koordinationsübungen zur Sturzprophylaxe empfohlen. Regelmäßige moderate körperliche Aktivität reduziert im Vergleich zur Inaktivität das Risiko, Vorhofflimmern zu erleiden bei Frauen um ca. 10 %, bei Männern sogar um ca. 20 %. Quelle: shape UP

Trainieren vertreibt schlechte Laune und wirkt sogar gegen Depressionen. Ganze Generationen von fitten Menschen würden auf diesen Glaubenssatz ihr letztes Trainingsshirt verwetten. Doch jetzt ziehen einige Psychater die Wirkung des Glückshormons Serotonin zur Behandlung von Depressionen in Zweifel. Sie verweisen darauf, dass bei depressiven Menschen kein Mangel an Serotonin nachweisbar sei. Wie jetzt – alles für die Katz? Wirkt Training doch nicht als Stimmungsaufheller? Professor Andreas Ströhle von der Berliner Charité widerspricht: „Dass Serotonin einen Einfluss auf die Stimmung hat, ist ja nicht ganz falsch, aber auch nicht so einfach, wie es klingt. Da wirken mehrere Faktoren zusammen.“ Einer der Faktoren ist körperliche Aktivität – oft vereinfachend als Sport bezeichnet. Die täglich zurückgelegten Schritte sind zwar noch kein Sport, aber sie haben offenbar einen Einfluss auf die menschliche Psyche. Welche klinischen Effekte eine Steigerung der täglichen Schrittzahl auf die Stimmung hat, untersucht Professor Ströhle derzeit im Rahmen einer Studie. Bewegung für die Psyche In der SAD-Studie („Schritte aus der Depression“) sollen 400 Patienten aus acht psychiatrischen Kliniken ihr tägliches Bewegungspensum von durchschnittlich 4.000 auf das von der Weltgesundheits-Organisation WHO empfohlene Maß von 10.000 Schritten erhöhen und dann beibehalten. Jede Woche sollten sie dabei 500 Schritte mehr schaffen. Fitness-Experten erhoffen sich dadurch auch Antwort auf die Frage, wie viel Training zur Entstehung des Glückshormons nötig ist, um gegen Depressionen wirksam zu sein. Denn außer Serotonin haben auch andere Stoffe Einfluss auf die Stimmung. Aber auch die entstehen im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten. „Beteiligt ist zum Beispiel auch „ANP“ (artriale natriuretische Peptid), ein Hormon, das im Herz-Muskel gebildet wird“, berichtet Professor Ströhle. „Schon vor 20 Jahren haben wir zuerst in Tierversuchen und vor 15 Jahren beim Menschen gezeigt, dass es gegen Angst wirkt.“ ANP und BDNF ANP entsteht aufgrund von Dehnungsreizen in den Muskelzellen des Herzvorhofes. Wodurch werden diese Dehnungsreize besonders intensiv ausgelöst? Richtig, durch körperliches Training. Auch BDNF (brain derived neurotrophic factor) verbessert das psychische Wohlbefinden. „BDNF,“ erklärt Studienleiter Ströhle, „stimuliert das Nervenwachstum und verstärkt die Bindung zu anderen Nerven. BDNF wird vermehrt durch sportliche Aktivitäten gebildet.“ BDNF wird zwar auch schon durch eine einzelne Trainingseinheit ausgeschüttet, die kontinuierliche Versorgung verlangt jedoch regelmäßiges und dauerhaftes Training – das entspricht also genau der Philosophie einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Was zu welchen Anteilen letztlich gegen Depressionen wirkt, darüber streiten noch die Gelehrten. Unbestritten ist, dass der Körper Serotonin aus der Aminosäure Tryptophan bildet und als Botenstoff zur Steuerung zahlreicher Prozesse einsetzt. Serotonin beeinflusst nicht nur Stimmungen und Emotionen, sondern regelt auch die Körpertemperatur, den Appetit, den Wach-Schlaf-Rhythmus und das Schmerzempfinden. Neben seinen Aufgaben innerhalb des Gehirns übernimmt Serotonin noch wichtige Funktionen in anderen Bereichen des Körpers. Es weitet die Blutgefäße, Bronchien und Darmzellen und stimuliert die Arbeit der Thrombozyten im Blut. Serotoninspiegel Der Serotoninspiegel kann durch Nahrungsmittel, Licht und körperliches Training erhöht werden. Der Grundstoff Tryptophan ist vor allem in proteinreichen Lebensmitteln wie Fisch. Fleisch, Sojabohnen und Erbsen enthalten. Auch die Vitamine B3 und B6 sowie Magnesium und Zink werden als Serotonin-Bausteine benötigt. Und Schokolade, Bananen oder Walnüsse sollen das Glückshormon sogar direkt ausschütten. Das gelangt dann zwar in den Körper, nicht aber ins Gehirn, den Ort, an dem die Gefühle entstehen. Dass Licht den Serotoninspiegel und die Stimmung hebt, wurde bereits von einer kanadischen Studie bestätigt, in der Frauen, die an einem Tryptophanmangel litten, mit hellem Licht bestrahlt wurden. Allerdings entsprachen die 3.000 Lux gerademal dem Tageslicht an einem bewölkten Wintertag. Da macht ein Gang auf die Sonnenbank nach dem Cooldown mehr Sinn. Rezept für Bewegung Wie bereits moderate Bewegung vor Depressionen schützen kann, hatten Forscher der University of New South Wales schon 2017 herausgefunden: Eine Stunde Training in der Woche reiche bereits, um die geistige Gesundheit zu verbessern – unabhängig von Geschlecht und Alter. Dabei käme es weniger auf die Intensität als vielmehr auf die Regelmäßigkeit des Trainings an. Norwegische Wissenschaftler bestätigten das Quantum Training nach einer elf Jahre dauernden Studie mit 34.000 Erwachsenen. Sie errechneten aus den Ergebnissen, dass zwölf Prozent aller Depression durch körperliche Aktivitäten verhindert werden könnten. Bewegungsmuffel hätten dagegen ein um 44 Prozent höheres Risiko depressiv zu werden. Allerdings habe die Studie auch gezeigt, dass eine Stunde pro Woche nicht ausreiche, um auch Angstzustände zu verhindern. „Wenn wir es schaffen würden, dass sich die Bevölkerung nur ein bisschen mehr bewegt, dann würde das nicht nur die seelische Gesundheit ganz enorm verbessern, sondern auch das körperlich Wohl“, zitiert das Berliner Zentrum der Gesundheit Professor Samuel Harvey, den Leiter der Studie. So gesehen staunt der Fachmann und der Laie wundert sich, dass die 5,3 Millionen Deutschen, die jährlich an einer Depression erkranken, nicht längst mit einem Rezept für Bewegung versehen therapiert werden. Dieses Rezept ist immerhin seit 2015 im Präventionsgesetz vorgesehen. Quelle: shape UP

1. Sportler schwitzen weniger Stimmt nicht. Wie stark man schwitzt, ist genetisch bedingt und damit individuell verschieden. Dennoch, Sportler transpirieren anders: Sie schwitzen schneller und produzieren nur so viel Schweiß, dass dieser direkt auf der Haut verdampft. Das kühlt den Körper sehr effektiv. Menschen mit geringer Fitness läuft der Schweiß eher am Körper herunter, ohne diesen wirklich zu erfrischen, da dicke Schweißtropfen schlechter verdunsten. Bei Trainierten enthält der Schweiß auch mehr Wasser; sie verlieren also deutlich weniger Elektrolyte als Unsportliche. 2. Die Fettverbrennung setzt erst nach 30 Minuten ein Dicker Irrtum. Fettverbrennung beim Training beginnt sofort. Wie viel verbrannt wird, hängt aber von der Kondition ab. Bei Sportlern greift der Körper stärker auf die Reserven im Fettgewebe zurück, bei untrainierten Menschen mobilisiert er zunächst anderweitig die benötigte Energie. Wenn Sie ein Krafttraining absolvieren, sollten Sie den sogenannten Nachbrenneffekt nicht unterschätzen, ein Mechanismus, der auch durch Essen, Trinken und Schlafen nicht unterbrochen wird. Darüber, wie lange das Nachbrennen anhält, herrscht Uneinigkeit. Als Höchstzahl sind 48 Stunden im Gespräch – das lässt sich aber wohl nur mit einem fordernden und intensiven Training erreichen. 3. Magnesium wirkt gegen Krämpfe Nein. Zwar kann Magnesiummangel zu Krämpfen führen, doch diese werden meist durch andere Faktoren ausgelöst: Flüssigkeitsmangel, zu wenig Schlaf, Fehlstellungen oder muskuläre Dysbalancen, Durchblutungsstörungen oder Alkoholkonsum. Als wirksameres Mittel gegen verkrampfte Muskeln gelten leichte Dehnübungen. 4. Am Muskelkater ist die Milchsäure schuld Nonsens. Milchsäure hat zu Unrecht einen schlechten Ruf: Sie reichert sich zwar in aktiven Muskeln an, wenn diese nicht genügend Sauerstoff erhalten. Aber statt das Gewebe zu schädigen, unterstützt sie die Erholung und Regeneration der beschädigten Zellen. Muskelkater geht in Wahrheit auf feine Risse in den Muskelzellen zurück, sogenannte Mikrotraumata. Dagegen hilft nicht mehr, sondern nur weniger und vor allem leichtere Bewegung. Auch Massagen oder Wärmeanwendungen können wirken. 5. Seitenstechen entsteht durch falsche Atmung Stimmt bedingt. Bei Seitenstechen handelt es sich wahrscheinlich um eine Irritation der Nerven in den Zwischenrippen. Die Ursache ist nicht zweifelsfrei geklärt: Neben falscher Atmung kommen auch eine verminderte Durchblutung von Milz oder Leber, ein krummer Rücken oder ein voller Magen infrage. Als „Erste-Hilfe-Maßnahme“ bei Seitenstechen sollte man das Lauftempo reduzieren und dann tief und regelmäßig Luft holen. 6. Problemzonen können gezielt wegtrainiert werden Hokuspokus. Beispiel Bauchmuskeltraining: Die Anzahl vergeblich durchgeführter Sit-Ups dürfte weltweit unermesslich hoch sein, denn ein Traumbauch ist nur bei einem insgesamt sehr geringen Körperfettanteil realisierbar. Dafür muss aber am gesamten Körper abgenommen werden. Ist der niedrige Körperfettanteil erreicht, macht das Trainieren der Bauchmuskeln natürlich Sinn, denn dann steht dem Sixpack in der Regel tatsächlich nichts mehr im Wege. 7. Auf Asphalt laufen schadet den Gelenken Running Gag. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für die Aussage, dass harte Untergründe den Gelenken besonders zusetzen würden. Zudem halten Sportmediziner die heutzutage erhältlichen Laufschuhe mit ihrer hohen Stoßdämpfung für kontraproduktiv. Sie verringern nämlich die Aktivität der Muskeln und führen zu einem instabileren Laufen. Nur Gelenke, die einer Belastung ausgesetzt sind, werden ausreichend durchblutet. Ansonsten ernährt sich der Knorpel schlechter und bildet sich zurück. Tun Sie Ihren Gelenken etwas Gutes und gehen Sie ruhig öfter barfuß. Bis man auch barfuß joggen gehen kann, brauchen die Strukturen der Füße Zeit einige Zeit der Gewöhnung. Wie lange diese Anpassung dauert, ist individuell sehr unterschiedlich, ein Jahr sollte man aber wenigstens einplanen. 8. Übergewichtige werden im Fitnessstudio angestarrt Wenn nicht gerade optisch komplett außergewöhnliche Fälle vorliegen, nein! Im Klartext heißt das: Mittrainierende interessieren sich schlichtweg für andere Dinge. Überhaupt sollten sich die Betroffenen nicht gleich einschüchtern lassen, wenn andere Menschen schlanker und durchtrainierter sind als sie. Wer sein Training im eigenen Tempo durchzieht, wird sich nach einiger Zeit gesünder und fitter fühlen, egal was die Waage anzeigt. 9. Frauen ruinieren sich mit Krafttraining ihre Weiblichkeit Quatsch! Erstens gibt es Krafttraining in sehr moderaten Varianten, wie beispielsweise bei manchen der EMS-Versionen und, zweitens, selbst wenn richtig viel Gewicht aufgelegt wird, drohen frau wegen ihrer naturgegebenen Konstitution keine unweiblich wirkenden Muskelberge. Dergleichen muss gewollt und durch Anabolikaeinnahme unterstützt sein. 10. Trainieren hilft beim Abnehmen Zum Schluss der Schock: Das sportliche Aktivität per se die Pfunde purzeln lässt, ist nur bedingt wahr. Beim Abnehmen kommt es in erster Linie darauf an, mehr Kalorien zu verbrennen als zu sich zu nehmen. Ist dies der Fall, reden wir von einer negativen Energiebilanz. Diese erreicht man durch weniger essen, mehr Bewegung oder einer Kombination aus beidem. Wer glaubt, man habe sich nach 30 Minuten auf dem Laufband gleich ein halbes Schwein verdient, irrt. Viele überschätzen den Energieverbrauch durch Sport massiv. Zum Trost: Wer seinen Körper fordert, insbesondere durch Krafttraining, wird Muskeln aufbauen. Und das führt dazu, dass tendenziell mehr Kalorien verbraucht werden. Neben den vorgestellten Mythen gibt es noch zahlreiche andere zum Thema Fitness. Leider stimmen nur die wenigsten. Lassen Sie sich also nichts vormachen und hinterfragen Sie immer scheinbar „ewig gültige“ Weisheiten. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude an der Bewegung! Quelle: shape UP

Von nichts, kommt nichts – in Trainingssprache übersetzt heißt das: Nur, wer sich beim Üben wirklich ins Zeug lohnt, erntet auch Lorbeeren. Das gilt besonders dann, wenn sich der viel beschworene Nachbrenneffekt einstellen soll. Möchtest du, dass sich deine Fatburn-Rädchen ab einem gewissen Punkt wie von selbst drehen, kommst du um intensives Training nicht herum. Nachbrennen bis zur höchsten Stufe Ein gewisses Nachbrennen gibt es bei spürbarer sportlicher Betätigung immer. Denn das Gleichgewicht unsere Körperfunktionen (Homöostase) wird durch Training & Co. grundsätzlich durcheinandergerüttelt. Diese Ruhestörung gilt es wieder auszugleichen, infolgedessen wird der Stoffwechsel hochgefahren. Der Körper kann dann gar nicht sofort auf Null schalten und schlagartig alle muskulären Fettverbrennungsaktivitäten einstellen. Das ist wie bei einer Heizung, wenn du die abdrehst, gibt sie noch eine ganze Weile Wärme ab. Wie lange die Nachwirkung anhält, hängt von dem zuvor erreichten Energie-Level ab. Das wäre beim Training die Intensität der Belastung. Wenn diese eine Stufe erreicht, bei der dein Körper dazu gebracht wird noch lange Zeit nach Übungsende und selbst im Schlaf recht fleißig Fett zu verbrennen, sprechen wir vom Nachbrenneffekt. Die Existenz dieses auch After-Burn-Effect oder EPOC/Excess Postexercise Oxygen Consumption genannten Phänomens ist unbestritten, wie es zu erklären ist, hingegen nicht. Impulse von ganz weit oben Über die exakten physiologischen Prozesse hinter dem EPOC wird spekuliert. Nach Auffassung des Molekularbiologen Eduardo Ropelle von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Limeira, Brasilien, spielt dabei ein Protein namens Interleukin-6 (kurz IL-6) eine wichtige Rolle. Primär löst es Entzündungen aus, aber es kann auch Gutes bewirken, denn beim und nach dem Sport sorgt es für die Verbrennung von Muskelfett. Durch Intensivierung der sportlichen Belastung kann die IL-6-Ausschüttung um das 100-fache im Vergleich zum Ruhezustand erhöht werden. Besonders interessant ist dabei, was Ropelle herausfand: Das Fett wird dank einer Nervenverbindung zwischen Hypothalamus, dem im Hirn befindlichen wichtigstem Steuerzentrum des vegetativen Nervensystems, und Muskel verbrannt. Während Interleukin-6 im Muskel schon bald nach der Belastung wieder zurückgeht und an Fatburn-Wirkung verliert, lässt das Protein den Hypothalamus weiterhin Nervensignale an die Muskeln abfeuern. Dies würde die lange Dauer des Nachbrenneffekts erklären und die alte Weisheit, dass Abnehmen auch eine Kopfsache ist, auf bisher nicht gekannte Art bestätigen. Alles nur Hype? Es gibt Stimmen, die meinen der EPOC würde zu sehr gehyped, der zusätzliche Kalorienverbrauch sei zwar gut, aber nicht zwingend notwendig. Das ist grundsätzlich richtig, aber verengt betrachtet. Denn im Großen und Ganzen gilt: Trainingsarten, die keinen oder nur einen geringen Nachbrenneffekt hervorrufen, sind für das Ziel „Abnehmen“ ungeeignet. Der EPOC ist also ein geradezu zwangsläufiger Begleiter erfolgreichen Fettreduktions-Trainings. Du kannst auf ihn zwar aus „Kaloriensicht“ verzichten, bekommst aber durch sein Auftreten einen sicheren Anhaltspunkt dafür, dass du richtig trainierst. Immer vorausgesetzt, dass du durch den Sport entweder Fett verlieren oder beim Essen und Trinken weniger Zurückhaltung üben möchtest. Bei anders gelagerten Trainingszielen spielt der Effekt tatsächlich kaum eine Rolle. Zahlen, bitte! Auszurechnen, was der EPOC wirklich bringt, ist äußerst schwer. Das Ergebnis hängt beispielsweise von Alter, Größe und Gewicht ab. Wie auch immer: Wenn Trainingsdauer und -intensität stimmen, kann anscheinend ganz schön was zusammenkommen. Die Bandbreite der Angaben schwankt dabei zwischen zehn und 40 Prozent. Heißt, wenn du beim eigentlichen Training beispielsweise 500 Kilokalorien (kcal) verbrennst, können im Nachgang bei optimistischer Betrachtung noch einmal 200 dazukommen. Bei einer US-amerikanischen Untersuchung der University of Wisconsin wurde festgestellt: Der Nachbrenneffekt wächst mit zunehmender Trainingsdauer linear, mit zunehmender Trainingsintensität sogar exponentiell. Ein besonders hoher EPOC wurde im Anschluss an ein High Intensity Intervall Training (HIIT) ermittelt. Dabei folgte auf 30-Sekunden-Belastungen mit mindestens 85 Prozent der maximal möglichen Leistung 30 Sekunden entschleunigtes Trainieren. Die Forscher sinngemäß: Kurze Wochentrainings mit um die 90 Minuten Gesamtdauer entfalten nur Abnehmwirkung, wenn sie hochintensiv sind. Solltest du also an schnellen Resultaten interessiert sein, ist HIIT ein echter Hit. So legst du den Schalter um Wenn es richtig krachen soll, müssen schon 60, besser sogar 90 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit abgerufen werden und das für mindestens zehn, besser 30 Minuten. Das sich Einstellen des Nachbrenneffekts ist, siehe oben, beim HIIT-Training besonders gut belegt. Wer also ohne Mehraufwand oder volkstümlich ausgedrückt, beim Faulenzen, zusätzlich Kalorien killen möchte, tut gut daran, ein entsprechendes Übungsprogramm zu fahren. Der Energieverbrauch steigt nach oben und hält dann abnehmend bis zu 48 Stunden an. HIIT bietet sich vor allem bei Ausdauersportarten an, weil sich bei ihnen sehr gut die Belastung variieren lässt. Zum Beispiel erst sprinten, dann traben. Für Laufband, Spinning-Bike, Rudergerät & Co. gilt also: Abwechselnd erst an die Belastungsgrenze gehen und dann wieder in den Normalbereich wechseln. Eine generelle Empfehlung für die Zeiteinteilung gibt es dabei nicht, da Intensitäts-Level und Ehrgeizgröße variieren. Eine Orientierungshilfe gibt es dennoch: Die Phase intensiver Belastung sollte zwischen 15 und 60 Sekunden liegen, der anschließende ruhigere Abschnitt doppelt oder dreimal so lang sein. Nach dem Kraftakt empfiehlt sich dringend eine dreitägige HIIT-Pause, damit sich speziell das strapazierte Nervensystem erholen kann. Was ist mit Kraftübungen? HIIT mit Kraftübungen geht auch, hier werden primär Bodyweight Exercises eingesetzt. Allerdings ist das zu wählende Verfahren anders, weil der Wechsel von intensiv zu moderat im Rahmen der Übung nicht funktioniert. Nehmen wir mal den Liegestütz als Beispiel. Die Ausführung ist ab einer gewissen Wiederholungszahl immer intensiv, denn moderate Push-ups gibt es schlicht und einfach nicht. Um dieses Problem zu umgehen, gibt es eine Vielzahl von Methoden. Eine bewährte ist zum Beispiel, den Erholungs-Part in Form von Pausen zu gestalten, bei denen du dich aber nicht hinsetzt, sondern in Bewegung bleibst. Auf der Stelle laufen ist denkbar, oder irgendetwas, bei dem du dich schüttelst, beugst oder dehnst. Sobald sich Puls und Atmung beruhigt haben, geht es von vorne los. Innerhalb eines Trainingsblocks wird zudem fast immer variiert. Also nicht nur, um beim Beispiel zu bleiben, Liegestütze sondern ein Übungs-Mix aus dem großen Fundus an Eigengewichtsübungen. Die ausgewählten Exercises, fünf ist hier ein guter Anzahlrichtwert, absolvierst du nacheinander und mit einer Frequenz, die dich bis kurz vor deine Grenze bringt. Das Ganze wiederholst du bis du die gewünschte Gesamttrainingsdauer erreicht hast. Stellschrauben für den Trainingserfolg Der Nachbrenneffekt ist umso größer: je mehr du dich der höchst möglichen Leistung (Tempo, Wiederholungszahl) näherst. 60 Prozent gelten als Minimum, 90 als Maximum. je länger die hochintensiven Phasen und je kürzer die moderaten andauern. Hier aber nicht übertreiben und in langsamen Schritten vorangehen: Erholung ist und bleibt wichtig. je ausgiebiger die Übungseinheiten sind. Die Trainingsdauer, wird durch die Anzahl der Intervalle bestimmt – insgesamt sollten mindestens zehn, höchstens aber 30 Minuten erreicht werden. Das anstrengendste Szenario wäre folglich ein 30-minütiges Training, bei dem die hochintensiven Phasen jeweils länger als die moderaten sind. Keine Option ist im Übrigen die Erhöhung der Trainingstage, dreimal die Woche ist fix, mehr wäre tendenziell gesundheitsschädigend. Gibt es Alternativen zu HIIT? Ja, grundsätzlich lassen sich eine Menge Sportarten intensiv betreiben, manche sind schon von ihrer Wesensart her hoch belastend. Genannt werden unter anderem Squash, Seilspringen Calisthenics (schwierige Eigengewichtsübungen) und Laufen mit mindestens zwölf Stundenkilometern. Auch mit Dance-Workouts auf gehobenem Fortgeschrittenen-Niveau lassen sich die nötigen Intensitäten fast immer erreichen. Gemeinsamer Nenner aller Aktivitäten ist, ist, dass du nach ihrer Durchführung wirklich richtig geschafft bist. Wichtig ist noch zu wissen: HIIT-Training bringt in Sachen Muskelaufbau eher wenig, dafür wäre unter anderem das begriffsverwandte HIT-Training (kurze Gewichtsübungen mit maximaler Spannung und Intensität) geeignet. Wie steht es um die Geschlechtergerechtigkeit? Der Nachbrenneffekt hängt natürlich von der Muskelmasse ab und da haben Männer schon die Nase vorn. Aber, halt – es gibt auch noch das Wachstumshormon. Dieses hat zwar nicht direkt mit dem EPOC zu tun, soll aber erwähnt werden, weil es bei Produktion und Wirkung auffällige Ähnlichkeiten gibt. Das unter diversen Namen (unter anderem Somatropin) bekannte Hormon wird nämlich im Hirnbereich gebildet und unterstützt unter anderem wirkungsvoll den Fettabbau. Eine Möglichkeit die Erzeugung zu pushen, ist intensives Trainieren. Auch eine nach allen Regeln der Kunst zelebrierte Nachtruhe ist hilfreich, denn auf dem Kopfkissen brodelt der Vulkan fleißig weiter und wirft vermehrt heiße Fatburner-Lava aus. Was hat das alles mit dem Geschlechtervergleich zu tun? Nun, Frauen sind bessere Wachstumshormon-Produzenten, der altersbedingte Ausschüttungsrückgang verläuft bei Männern schneller. Es scheint zudem so, dass weibliche Personen eine stärkere Wachstumshormonreaktion beim Trainieren zeigen. Warnhinweis Den Nachbrenneffekt herauszukitzeln fordert den Körper extrem. Also Warm-up und Cool-down nicht vergessen. Hochintensives Training ist zudem definitiv nicht für alle geeignet. Untrainierte sollten einen Bogen darum machen, denn meist sind weder Ausdauer, noch Bindegewebebelastbarkeit und Gelenkstabilität ausreichend vorhanden. Das gilt auch für stark Übergewichtige. Insgesamt fehlt die Energie, intensiv trainieren zu können. Die Muskulatur weist weniger Mitochondrien auf, damit fehlt es an zellinternen „Kraftwerken” für die Fettverbrennung. Untrainierte und Übergewichtige benötigen daher Geduld und einen systematischen Trainingsaufbau, bis sie Abnehmerfolge durch Sport erzielen. Das kann Monate, mitunter sogar Jahre dauern. Personen mit Vorerkrankungen oder akuten Verletzungen sollten ebenfalls zu großen Belastungen aus dem Wege gehen. Wenn du unsicher bist, hol dir am besten ein „Go” aus der Arztpraxis. Und: Wer eh keine Lust hat, sich zu schinden, braucht auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Der EPOC ist ein „nice to have” aber ganz bestimmt kein „must”. Der beste Sport ist immer der, bei dem du deine Trainingsziele mit einer guten Portion Spaß erreichst. Quelle: shape UP

Nicht nur die Anfänger sollten einen Herzfrequenzmesser nutzen, anhand dessen sie ein sicheres Kardiotraining durchführen können. Bevor du mit dem Training auf einem Fahrradergometer beginnst, solltest du zudem auf die korrekte Trainingsposition achten. Wichtig dabei sind vor allem diese fünf Kontaktpunkte: Zwei Hände am Handgriff, zwei Füße auf den Pedalen und der Beckenboden auf dem Sattel. Passe den Fahrradergometer deinem Körperbau an, indem du die Position des Lenkers und des Sattels entsprechend einstellst. Bei einer falschen Trainingsposition können Probleme auftreten: Wenn der Sattel etwa zu hoch ist, müssen die Muskeln der Oberschenkel den Pedaldrehungen folgen, was zu einer Überlastung der Muskeln und zu einer schnellen Ermüdung führt. Fit durch Spinning Indoorcycling, auch Spinning genannt, bietet sich als eine hervorragende Alternative zum Radfahren an. Die Wirkung variiert je nach Trainingsziel: Wenn du abnehmen, deine Ausdauer verbessern oder deine Beinmuskeln stärken willst, ist Spinning eine gute Wahl. Spinning ist aus vielen Gründen so erfolgreich. Ein gutes Training des Herzkreislaufsystems Die Mischung aus individuell einstellbarer Intensität und der Überwachung der Herzfrequenz führt zu einem gesundheitsbewussten Training. Außerdem können die Trainingsvorgaben eines Outdoor-Trainings mit einem Spinningrad gut umgesetzt werden. Gelenkschonend Bei Problemen mit Knien, Rücken oder Hüfte stellt sich Spinning sehr gut als Alternative dar und ist dem Radeln auf der Straße sogar überlegen. Das Schwungrad ermöglicht nämlich eine wesentlich flüssigere Übersetzung und das Treten wird dadurch gelenkschonender. Motivation Das gemeinsame Training in der Gruppe steigert die Motivation. Jedes Work-out wird somit zu einem freundschaftlichen Wettbewerb unter Gleichgesinnten. Du kannst dich dabei gegenseitig zu neuen Bestleistungen anspornen. Kraftausdauer Spinning ist bestens dazu geeignet, die Kraftausdauer zu verbessern. Du kannst dabei im anaeroben Bereich an die eigenen Grenzen gehen und gleichzeitig die Ausdauer- und die Kraftleistungen steigern. Rumpfmuskulatur Spinning beansprucht neben den Beinen auch die vorderen und seitlichen Bauchmuskeln sowie den Rückenstrecker. Das geschieht insbesondere dann, wenn das Tempo erhöht wird und du im Stehen radelst. Der Rumpf leistet dann einiges an Ausgleicharbeit. Stressreduktion Nach einem hektischen Arbeitstag wirkt sich eine Spinningeinheit stressabbauend aus. Eine wohlige Erschöpfung und eine ordentliche Portion Endorphine sind nach einem harten Spinningtraining die Belohnung. Was Neulinge beachten sollten Spinning ist eine Trainingsform, die zwar dem Radfahren im Freien ziemlich ähnlich ist, allerdings gibt es dabei einige Punkte zu beachten. Freunde dich zunächst mit dem Rad an: Das stationäre Rennrad hat seine Besonderheiten. Darunter sind vor allem die richtige Sitzposition, die korrekte Armhaltung, das Einstellen des Widerstands, das Bremsen und der sogenannte runde Tritt von Bedeutung. Lass dir am besten erst von einem Trainer das Rad erklären und bei der Einstellung helfen. Trinke ausreichend während des Trainings: Im Kursraum gibt es, anders als im Freien, keinen Fahrtwind, der abkühlt. Du schwitzt deshalb stark. Bei einem 60-minütigen Training solltest du deshalb mindestens einen Liter Wasser oder Isogetränk trinken. Verwende normale Radklamotten: Radlerhosen mit Polsterung im Gesäßbereich sind für Spinning bestens geeignet. Radtrikots sind angenehm zu tragen und meist aus einem funktionellen Material hergestellt, womit der Schweiß nach außen transportiert wird. Tritt ohne Pause: Ein Spinningrad hat im Gegensatz zu einem normalen Rennrad keinen Leerlauf, sondern ein sogenanntes Schwungrad. Die Kraftübertragung ist dabei um einiges besser und der Bewegungsablauf runder, allerdings musst du pausenlos treten. Die sogenannten Rollphasen fallen beim Indoorradfahren weg, was eine höhere Grundaktivität bedeutet. Krafttraining für Rennradfahrer Das Krafttraining ist sowohl für die Radprofis als auch für ambitionierte Radler ein Muss, und zwar bevorzugt während der kalten Jahreszeit. Sie trainieren an der Beinpresse oder machen Kniebeugen im Fitnessstudio, um sich für die neue Saison starke Grundlagen für steile Berge oder schnelle Sprints zu erarbeiten. Krafttraining im Radsport soll vor allem der Steigerung der Maximalkraft dienen. Die Maximalkraft ist als Basis von radspezifischen Kraftformen wie Schnellkraft und Schnellkraftausdauer anzusehen. Je höher die Maximalkraft, desto effizienter die Muskelarbeit während der Belastung. Wenn die Belastung etwa 60 Prozent der Maximalkraft erreicht, schwillt der arbeitende Muskel an und drückt dabei auf die Blutgefäße, was zu Verengungen führt. Die Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff ist dann nicht mehr optimal und die Ausdauerleistungsfähigkeit sinkt dadurch. Viele Radsportler sind deshalb skeptisch gegenüber dem Krafttraining, weil sie einen zu großen Muskelzuwachs befürchten. Die Befürchtungen sind jedoch grundlos: Sogar bei idealen Voraussetzungen, wie eine gute Glukoseversorgung und Sauerstoffverfügbarkeit, sind in der Regel Monate nötig, um einen signifikanten Muskelzuwachs zu erreichen. Zu Beginn werden Kraftgewinne aus einer verbesserten intermuskulären und intramuskulären Koordination erreicht. Im Klartext heißt das, dass die Muskeln dank Krafttraining bestimmte Lerneffekte erzielen. Das führt bei der Beinmuskulatur dazu, dass die Beinstrecker, Beinbeuger und Wadenmuskeln harmonischer miteinander arbeiten (intermuskuläre Koordination). Bei einem verbesserten Zusammenspiel von Nerven und Muskeln, also wenn die Muskeln lernen, mehr Muskelfasern einzusetzen, handelt es sich um intramuskuläre Koordination. Die Transfereffekte nutzen Das Krafttraining für Radfahrer sollte vor allem die erwarteten Kraftzuwächse optimal auf das Radtraining übertragen. Hier spielt im Training die Position des Trainierenden eine führende Rolle. Die Körperhaltung sollte deshalb bei den einzelnen Übungen der Position auf dem Rad so weit wie möglich angepasst werden. Halte die Gewichte so, als würdest du auf dem Rad sitzen. Alle Übungen für die Beine sollten zudem möglichst einbeinig ausgeführt werden. Ein solches Training ist auf jedem Fall effektiver und eventuelle Kraftunterschiede lassen sich somit frühzeitig erkennen. Baue wie beim jedem herkömmlichen Krafttraining auch die Aufwärmphase mit ein. Das gelingt am besten mit einem Aufwärmsatz à 20 Wiederholungen am entsprechenden Gerät und mit einem sehr geringen Gewicht. Zu Beginn solltest du mit relativ geringen Gewichten, dafür aber mit höheren Umfängen, trainieren. Das Gewicht soll langsam gesteigert werden, während die Zahl der Wiederholungen erst im späteren Verlauf der Gewöhnungsphase verringert wird. Danach kommt erst die Aufbauphase, die zehn bis zwölf Wochen dauert. Das optimale Muskelwachstum erreichst du mit drei bis vier Sätzen à acht bis 15 Wiederholungen, wobei die Intensität des Trainings 60 bis 90 Prozent der maximalen Leistung betragen sollte. Quelle: shape UP

Vor allem im Frühling und Sommer ist Asthma-Zeit: Wer darunter leidet, wagt sich nur selten ins Fitnessstudio. Eine falsche Entscheidung. Denn mit dem richtigen Training kann man viel Gutes für seine Gesundheit tun. Asthma gehört inzwischen in Deutschland zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Zehn Prozent aller Kinder unter 15 Jahren und fünf Prozent der Erwachsenen sind betroffen – rund vier Millionen Deutsche, 10 Prozent sogar mit schwerem Asthma. Das kann den Alltag ganz schön einschränken – an Sport wollen viele Betroffene da gar nicht erst denken. Denn viele Betroffenen machen bei körperlicher Anstrengung negative, manchmal gar bedrohliche Erfahrungen: Husten, pfeifende Atmung, Luftnot. Nicht Abhilfe – gegen Asthma gibt es derzeit noch keine Therapie – aber Linderung der Symptome kann mit einem auf die Erkrankung zugeschnittenen Training erreicht werden. Denn ein regelmäßiges körperliches Training verbessert die Lungenfunktion und den Gasaustausch, steigert die Herz-Leistungsfähigkeit und die Sauerstoffnutzung in den Muskeln. Gerade mit einem Fitness-Training können Asthmatiker viel gegen die Erkrankung und noch mehr für die allgemeine Gesundheit tun. Denn: Fitness-Training trainiert die Atemmuskulatur. Heißt: Die Peak-Flow-Werte verbessern sich. Fitness-Training stärkt die Lungenfunktion. Heißt: Die Schwelle, bei der die Atemnot einsetzt, verschiebt sich nach oben. Fitness-Training verbessert die Ausdauer. Fitness-Training wirkt depressiven Stimmungen entgegen, unter denen viele an Asthma-Erkrankte leiden. Und: Fitness-Training hilft zu entspannen. Wer also regelmäßig trainiert, verbessert seine Lebensqualität und kann seine Beschwerden minimieren. Das belegt auch eine Studie der kanadischen Concordia-Universität. Sie stellte fest, dass Asthmapatienten, die regelmäßig trainieren, eine zweieinhalb Mal so gute Kontrolle über ihre Asthma-Beschwerden haben wie diejenigen ohne tägliche Bewegung. Konkret: Die Mediziner bildeten zwei Gruppen, die eine trainierte zweimal die Woche je 30 Minuten, die andere trainierte nicht. Nach drei Monaten wurden die Werte der beiden Gruppen verglichen. Ergebnis: Die Trainierenden waren im Monat circa 24 Tage symptomfrei – die sportfreie Kontrollgruppe nur an 16 Tagen. Das richtige Training Allerdings muss man auf die richtige Zusammenstellung der Trainingseinheiten achten. Nicht empfehlenswert sind Trainings mit kurzen und heftigen Belastungsphasen. Das könnte sogar kontraproduktiv sein und die Beschwerden verschlimmern. Die deutsche Atemwegsliga empfiehlt ein Training, dass „die gesamte Motorik verbessert. Eine höhere Qualität der Motorik hat einen geringeren Energiebedarf zur Folge und senkt damit die Gefahr einer Hyperventilation.“ Wichtig ist, dass du vor dem Trainingsstart mit deinem behandelnden Arzt einen ergonomischen Belastungstest durchführst. Damit kann deine allgemeine körperliche Fitness sowie die Leistungsfähigkeit der Lunge festgestellt werden. Auf Grundlage dieser Testergebnisse kann dann deine Trainerin oder dein Trainer einen personalisierten Trainingsplan erstellen, der genau an deine Kondition und Belastungsfähigkeit angepasst ist. Wichtig dabei, dass die einzelnen Trainingseinheiten gleichmäßig belasten, also verändere nicht abrupt die Anstrengung. Zu Beachten Wenn du durch körperliche Überanstrengung regelmäßig Asthmaanfälle erleidest, solltest du vorbeugend ein Medikament mit bronchienerweiternden Wirkstoffen inhalieren. Beim Training selbst immer ein Notfallspray griffbereit halten. Vor dem Trainingsbeginn unbedingt eine Aufwärmphase einplanen. Ein „Kaltstart“ kann zu einer Verengung der Bronchien mit zunehmender Hyperventilation und Atemnot führen. Während des Trainings vermeide abrupte Wechsel zwischen Ruhe- und Belastungsphasen. Und nicht überanstrengen, das kann zu Atemnot, Hustenanfällen und Hyperventilation führen, dem sogenannten Belastungsasthma. Also immer kurze Entspannungsphasen in die Trainingseinheit einbauen. Apropos Krafttraining: Auch damit stärkst du die Atemmuskulatur. Insbesondere das Training der Schulter-, Bauch und Rückenmuskulatur lindert Asthmaanfälle. Jede Trainingseinheit solltest du mit einer Cool-Down-Phase abschließen, also mit Atemübungen und etwas Gymnastik beenden, um den Kreislauf langsam wieder runterzufahren. Sport ist wichtiger als Medikamente Sportmediziner empfehlen dreimal die Woche ein Training bis 45 Minuten. Denn besser, du setzt auf mehr Wiederholungen bei mäßiger Intensität als auf wenige Trainings mit starker Belastung. Der Ulmer Pneumologe Dr. Michael Barczok und Autor des Buches „Luft nach oben: Wie richtiges Atmen stärker macht“ fasst seine Erkenntnisse so zusammen: „Zwar kann man die Lunge nicht trainieren, aber die Brustkorbmuskulatur erheblich ausbauen und die leicht entzündbaren Schleimhäute von Asthmatikern resilienter gegen Infekte und Erreger machen. Deshalb ist Sport noch wichtiger als Medikamente, um alltagstauglich zu bleiben.“ Übrigens: Was haben Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma, Leichtathletin Cathy Freeman und Schwimmer Mark Spitz gemeinsam? Sie alle sind Olympiasieger – und haben Asthma. Quelle: shape UP

Es gibt gute Gründe, warum Sie gerade bei heißen Temperaturen nicht auf das Work-out im Sportclub verzichten sollten. Sich lieber in der Sonne abrackern oder gar eine lange Trainingspause einlegen kann nämlich unerwünschte Folgen haben. Erfahren Sie nun die Einzelheiten. Dass man, egal zur welcher Jahreszeit, etwas für seinen Körper tun sollte, dürfte mehr oder weniger unumstritten sein. Eine super-praktische Eigenschaft des Fitnessstudios ist dabei: Sie können trainieren, egal wie’s draußen aussieht. Es schützt Sie vor der prallen Sonne aber auch bei Regen und Gewitter kommen Sie sicher und trocken ans Ziel. Der kühle Komfort im Club ist gerade fürs Sommertraining angeraten, denn das Work-out im Studio ist tendenziell besser fürs Wohlbefinden als ein anstrengendes Outdoor-Training. Wobei wir gleich bei einem zentralen Punkt wären: Indoor ist bei Hitze risikoärmer als Outdoor Outdoor-Training kann unter gewissen Umständen zu Hitzeerkrankungen führen – eine Gefahr, die im klimatisierten und sonnengeschützten Sportclub nicht besteht. Die drei häufigsten Hitzeerkrankungen sind Hitzekrämpfe, Hitzeerschöpfung und Hitzschlag. Sie werden durch eine Störung der körperlichen Thermoregulation verursacht. Im Sport tritt diese in der Regel auf, wenn die Schweißabgabe nicht in der Lage ist, die Körperwärme ausreichend abzuführen. Wichtigste auslösende Faktoren sind eine hohe Lufttemperatur und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die ungünstigen Bedingungen können durch eine geringe Windgeschwindigkeit am Körper und eine hohe Hitzestrahlung direkt durch die Sonne oder reflektorisch durch den Boden noch verstärkt werden. Hinzu kommt bei sportlicher Aktivität die entstehende Körperwärme, die von der Intensität und von der Länge der Belastung abhängt. Gerade das Joggen hat im Sommer Hochkonjunktur. Warum das Laufband im Studio die bessere Alternative sein könnte, lässt der Wittener Sportwissenschaftler Klaus Möhlendick durchblicken. Wer es mit dem Laufen bei Hitze übertreibt, dem drohen nach seinen Worten Magenprobleme, Schwindel oder Kopfschmerzen. In diesen Fällen sollte man vorsichtshalber das Training besser ganz abbrechen. „Beim Joggen kommt es auch auf die Uhrzeit an. Am besten läuft man frühmorgens oder spätabends, wenn die Temperaturen angenehmer sind und der Kreislauf nicht zu stark belastet wird“. Außerdem seien morgens die gesundheitsgefährdenden Ozonwerte am niedrigsten. Vorsicht wäre auch bei Tempoläufen geboten, diese sind nur etwas für gut trainierte Sportler, die sommerliche Temperaturen vertragen. Doch selbst geübte Jogger sollten lange Streckenabschnitte in der Sonne meiden und soweit möglich im Schatten laufen. Es gibt als etliche Einschränkungen, die Indoor allesamt kein Thema sind. Und noch etwas: Dass man sich im Studio einen Sonnenbrand einfängt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Dies ist insofern bedeutend, als das Hautkrebs, der auch Jahre nach einem erlittenen Sonnenbrand auftreten kann, zu den Krebsarten mit steigender Fallzahl gehört. Ursache für den Anstieg ist vermutlich der Klimawandel. Dieser führt zu mehr Tagen mit hohen UV-Werten und wirkt sich auch negativ auf die schützende Ozonschicht aus. Das bedeutet, dass die UV-Belastung für jeden Einzelnen steigen kann und damit auch das Risiko für ernsthafte Erkrankungen der Haut und der Augen. Kurzum: Intensiver Outdoorsport (dazu zählt nicht das Schwimmen) ist bei großer Hitze potentiell risikobehaftet. Für alle, die mit hoher Schlagzahl trainieren möchten, sollte Indoor daher die erste Wahl sein. Gar nichts tun, wäre aber auch noch eine Alternative, oder? Nicht wirklich, denn Trainingspausen haben auch so ihre Tücken. Keine zu langen Auszeiten nehmen Vielleicht sind Sie ja der Meinung, man würde sich im Sommer automatisch mehr bewegen als in den anderen Jahreszeiten. Nun wird wahrscheinlich das Rad öfter genutzt, manche Runde im Freibad „gedreht“ und oft steht auch Gartenarbeit auf dem Programm. Viele glauben diese Kleinigkeiten würden ausreichen, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Doch das ist weit gefehlt. Bekommt der Muskel nicht die richtigen, zielgerichteten Trainingsreize, baut er ab. Das passiert schleichend, aber schneller als man denkt. Wenn Sie also im Sommer auf Studiobesuche verzichten, wird es im Herbst deutlich schwieriger, die Trainingsroutine wieder aufzunehmen. Um die Leistungsfähigkeit zu erhalten, sollten Sie mindestens einmal pro Woche – besser zweimal – ein Fitnesstraining absolvieren. Dies wirkt sich übrigens auch positiv auf die Produktion des Glückshormons Endorphin aus. im Zusammenspiel mit dem, ebenfalls die Endorphinausschüttung begünstigenden, Sonnenlicht werden Sie sich trotz Anstrengung vermutlich fantastisch fühlen. Sommerliche Work-outs fördern den Schlaf Viele wissen, was es bedeutet, an warmen, milden Sommernächten schlaflos zu sein. Anstatt sich von einer Seite zu anderen zu wälzen, gibt es auch für Schlafprobleme eine Lösung: Work-out! Regelmäßiges Training fördert einen tieferen und längeren Schlaf und lässt Sie an in warmen Nächten auch schneller einschlafen. Klar, das bekommt man natürlich auch mit Outdoor-Sport hin, aber da dieser bei Hitze grundsätzlich moderat gehalten werden sollte, ist das richtige Auspowern völlig risikolos nur im Sportclub möglich. Merke: Training zahlt sich nicht nur dank Nachbrenneffekt im Dunkeln aus! Und noch drei Vorteile: Fitter beim Job. Die nutzbringenden Effekte von Bewegung für das Gehirn gelten weitgehend als belegt. Neben besserem Lernverhalten gehören positive Auswirkungen auf Konzentration und Aufmerksamkeit dazu. Das wiederum ist besonders bei warmen Temperaturen wichtig. Mehr Komfort. Da der Körper im Sommer mehr Flüssigkeit benötigt, trinken wir auch mehr. Outdoor heißt das, immer Flaschen mit sich herumschleppen zu müssen. Im Club stehen Ihnen Wasser oder andere Getränke dagegen jederzeit zur Verfügung. Weniger Rummel. Da im Sommer mehr Leute an der frischen Luft oder im Urlaub sind, ist auch im Studio weniger los. Hinsichtlich der Wartezeit an superbegehrten Geräten ist das eine prima Nachricht. Und auch Newcomern, die sich vielleicht noch etwas unsicher fühlen, kommt die relative Ruhe sehr zugute. Also, nichts wie ab die Post! Effektiv trainieren braucht nicht viel Zeit. Damit fällt die beliebte Ausrede, bei schönem Wetter besseres zu tun zu haben, schon mal weg. Reduzieren Sie das Krafttraining gegebenenfalls auf wenige komplexe Übungen. Dann schaffen Sie es danach sogar noch pünktlich zum Grillabend mit Freunden oder wohin es Sie sonst auch zieht. Quelle: shape UP

Manche Problematiken äußern sich bei Frau und Mann anders, entsprechend müsste es eigentlich auch Differenzierungen in der Diagnostik und Behandlung geben. Dies ist aber nicht immer der Fall. Eine medizinische Versorgung, die sich um „den Patienten“ als eine Art geschlechtloses Wesen kümmert, greift daher viel zu kurz. Eine Forschungsrichtung, die sich dafür einsetzt, dass auch in der klinischen Praxis die körperlichen Unterschiede zwischen Frauen und Männern und deren Auswirkungen auf die Gesundheit viel mehr berücksichtigt werden, ist die Gendermedizin. Herzerkrankungen sind dabei ein sehr wichtiges Betätigungsfeld. Gerade beim Klassifizieren von Symptomen wäre ein Bruch mit der oft noch praktizierten Gleichmacherei wünschenswert. Herzinfarkt und Broken-Heart-Syndrom sind dafür beste Beispiele. Unabhängig davon gibt es aber auch abseits von Genderproblemen Geschlechterunterschiede bei Herzensangelegenheiten. Hier wären Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen an prominenter Stelle zu nennen. Infarktwarnung weniger eindeutig Ein Beispiel für die Benachteiligung von Frauen ist der Herzinfarkt. Er wird gemeinhin eher als Risiko für Männer gesehen. Zögern Frauen deshalb länger, bis sie den Notruf wählen? „Häufiger als bei Männern können bei Frauen weniger eindeutige Symptome auftreten, etwa Atemnot, ein Ziehen in den Armen, unerklärliche Müdigkeit, Übelkeit oder Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch oder Rücken“, erklärt die Kardiologin Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher, Chefärztin am Marienhospital im nordrhein-westfälischen Wesel. Das heißt, dass ein Infarkt bei Frauen aufgrund ganz anderer, sehr unspezifischer Symptome als solcher oftmals nicht so klar zu erkennen ist wie bei einer Person des anderen Geschlechts. Herz öfters gebrochen Ein weiteres Herzleiden, das Frau und Mann unterschiedlich trifft, ist das sogenannte Broken-Heart-Syndrom. Diese Herzmuskelerkrankung kommt beim weiblichen Geschlecht viel häufiger vor. Die Einschränkung der Herzleistung wird hier nicht wie beim Infarkt durch ein verstopftes Herzkranzgefäß verursacht, sondern meist durch ein belastendes emotionales Ereignis. Betroffene leiden unter den oben beschriebenen klassischen Infarktsymptomen, der Unterschied zwischen den Anzeichen gebrochener und kollabierender Herzen ist für Laien daher kaum zu erkennen. Bei einer Frau mit entsprechend Beschwerden sollte also ärztlicherseits die Möglichkeit „Broken-Heart-Syndrom“ immer mitgedacht werden. Fragen nach Auslösern sind wichtig. Als solche gelten Ausnahmesituationen, wie Liebeskummer, Gewalterlebnisse, Mobbing, Depressionen oder der Verlust eines geliebten Menschen. Auch freudige Ereignisse können einem „das Herz brechen“. Entscheidend ist der Stress. Egal, ob positiv oder negativ führt er dazu, dass vermehrt Hormone wie Adrenalin und Noradrenalin ausschüttet werden. Das Herz verfällt in eine Art „Schockstarre“ und ist dadurch in seiner Pumpleistung stark eingeschränkt. So kann im Extremfall gar ein Herzstillstand drohen, was in fünf Prozent der Fälle den Tod bedeutet. Überwiegend erholt sich das Herz von einem Broken-Heart-Syndrom aber meist sehr schnell wieder von selbst. Dennoch: Wer Anzeichen spürt, sollte sich schnellstens untersuchen lassen. Herz überwiegend schwächer Dass Herzschwäche (Herzinsuffizienz) mit einer ungünstigeren Prognose für Frauen einhergeht, dokumentiert alljährlich der Deutsche Herzbericht. Die Kardiologin Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek, von 2007 bis 2019 Direktorin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin, Charité Berlin, erläutert die Hintergründe. Die „weibliche Benachteiligung“ gehe unter anderem auf eine schlechtere Füllbarkeit des Herzens zurück, weil das Organ aufgrund seiner kleineren Größe steifer und weniger elastisch als das männliche Herz ist. Männerherzen seien dagegen häufiger von einer gestörten Pumpfunktion betroffen. Herz aus dem Takt Bestimmte Herzrhythmusstörungen kommen häufiger bei Männern vor, andere vorwiegend bei Frauen. Die häufigste Störung Vorhofflimmern mit bis zu 1,8 Millionen Betroffenen ist zwar mehr bei Männern anzutreffen, Frauen erleben dadurch jedoch eine stärkere Beeinträchtigung ihres Alltags. Herzrhythmusexpertin Prof. Dr. Isabel Deisenhofer vom Deutschen Herzzentrum München, führt aus: „Die schwerwiegendste Folge von Vorhofflimmern, der Schlaganfall, scheint den Studien nach bei Frauen zwischen dem 65. und dem 75. Lebensjahr häufiger als bei Männern aufzutreten.“ Hingegen ist das Risiko einen plötzlichen Herztod aufgrund von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen zu erleiden, bei Frauen „in der Tat deutlich niedriger als bei Männern“. Mediziner erklären diesen Unterscheid damit, dass dem plötzlichen Herztod fast immer eine Herzerkrankung zugrunde liegt. Häufigste Ursache ist dabei die koronare Herzkrankheit (KHK), an der Frauen aber viel seltener erkranken als Männer. Dennoch gilt die Ursache für den auffälligen Geschlechtsunterschied beim plötzlichen Herztod aktuell als noch nicht ausreichend erforscht. Insgesamt kein einheitliches Bild Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Frauen sind in Sachen Herzerkrankungen nicht durchgängig benachteiligt sind. Während sie bei der Infarkterkennung, beim Broken-Heart-Syndrom und in Sachen Herzschwäche ungünstigere Voraussetzungen haben, bleiben sie vom plötzlichen Herztod tendenziell eher verschont. Wichtig ist in jedem Fall die Erkenntnis: Frau und Mann sind auch in medizinischer Hinsicht oft unterschiedlich. Frauen ziehen dabei mehrheitlich den Kürzeren, denn bis sich in den 1990er Jahren die Gendermedizin etablierte, orientierten sich medizinische Leitlinien, Medikamente und Forschungen vornehmlich am männlichen Patienten. Gendermedizin kommt aber auch diesen zugute. Für Männer sind zum Beispiel Osteoporose oder Depressionen wichtige Krankheitsbilder, die lange Zeit nicht sensibel genug erforscht wurden. Insgesamt herrscht beim weiblichen Geschlecht aber der weitaus größere Aufholbedarf. Quelle: Shape-Up